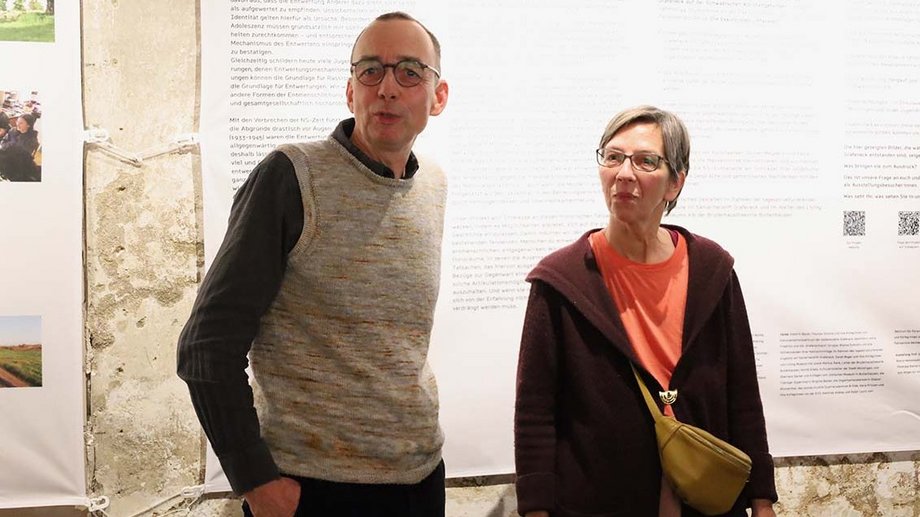Ausstellungseröffnung zum Projekt „Grafeneck – Münster // 1940 – heute“ gut besucht
„Es geht uns um ein Wissen, das nicht nur gelernt, sondern gelebt wird.“ Mit diesem Zitat des Historikers und Psychoanalytikers Roger Frie öffnete am 17. Januar die Ausstellung „Was hat die Ermordung von Menschen mit Behinderungen während des Nationalsozialismus mit uns zu tun?”. Sie findet bis zum 31. Januar im Kulturzentrum B-Side in Münster statt. Die Ausstellung handelt von vier Exkursionen, die Studierende der Abteilung Münster im Jahr 2024 nach Grafeneck auf der Schwäbischen Alb unternommen haben, um sich dort mit den Verbrechen auseinanderzusetzen, die man als NS-‚Euthanasie’ bezeichnet. Grafeneck war 1940 der erste Tatort dieser systematischen Massenmorde: Innerhalb eines Jahres wurden dort über zehntausend Menschen umgebracht, indem sie vergast wurden.
Die Eröffnung war gut besucht. Schon bevor die Vernissage durch eine Rede von Prof. Dr. Jochen Bonz eingeleitet wurde, waren im Kulturzentrum B-Side am Hafen in Münster etliche Besucher_innen anwesend und schauten sich um. Aufgespannt sind dort drei Banner: ein Einführungstext, Fotos von den Exkursionen und gedruckte Fotos von Bildern, die Studierende der katho bei den Exkursionen gemalt haben.
Farbenfrohe Kunstwerke auf sieben Meter langen Banner sind besonders aufsehenerregend
Besonders viel Aufmerksamkeit erregte das sieben Meter lange Banner – voll von farbenfrohen Kunstwerken. „Was bedeutet die Farbigkeit unserer Bilder im Zusammenhang unserer Auseinandersetzung mit der NS-‚Euthanasie‘?“, stellte Bonz als Frage in den Raum. Die Ausstellung selbst gibt darauf keine Antwort. Sie schafft einen Raum zwischen den drei Ausstellungselementen. Es kann ein Raum für Gedanken und Gefühle zum Thema sein, mit denen man als Betrachtende selbst die Ausstellung vervollständigt. An diesem Eröffnungsabend konnte man an sich selbst erleben und an anderen sehen, wie das Betrachten Nachdenklichkeit und viel lebendigen Austausch auslöste.
„Die expressive Qualität der Kunst, ihre kommunikative Breite, ihre Vielschichtigkeit und Bedeutungsoffenheit ist für uns entscheidend“, erläuterte Bonz. „Und auch das eigene künstlerische Tätigwerden, das bei unseren Exkursionen und bei den Workshops, die wir jetzt mit Schulklassen durchführen, auf die Auseinandersetzung mit den historischen Tatsachen folgt, braucht es“, so der Projektleiter weiter, „es ermöglicht, die historischen Schrecken überhaupt aushalten zu können, also: mit ihnen leben zu können, ohne sie verdrängen zu müssen.“
Die Ausstellung zeigt viele der Bilder, die auf den Exkursionen im Rahmen tagesstrukturierender Angebote des Samariterstifts Grafeneck und des Living Museum Alb in Buttenhausen entstanden sind. Etliche der dort entstandenen Bilder zeigt sie aber auch nicht, zum Beispiel einen Fisch, den eine Studentin gemeinsam mit einer Bewohnerin des Samariterstifts gemalt hat. Er hängt jetzt in Grafeneck auf dem Flur des einzigen Stockwerks des Schlosses, das noch genutzt wird. Die gut 70 Bewohner_innen leben heute in modernen Pavillons. Andere Bilder sind auf unterschiedliche Weise ‚verloren gegangen’. So beispielsweise im Druck ein Bildtext, indem er unleserlich wurde. Er lautet: „Das Schloss zerfällt – Das Vergehen der Zeit wird sichtbar – Seelen haben Widerhaken – Sie sind müde.“
Projektleiter Bonz und Kuratorin Wessalowski erläuterten das Motiv des Verlusts
In ihren Eröffnungsansprachen griffen die Kuratorin und Gestalterin der Ausstellung Bianca Wessalowski und Jochen Bonz das Motiv des Verlustes jeweils auf. Die heutige erinnerungskulturelle, gedenkstättenpädagogische Auseinandersetzung mit der NS-‚Euthanasie‘ sei von dem Bedürfnis durchzogen, dass die Opfer einen Namen erhalten sollen, dass sie eine Gestalt annehmen, dass sie eine Stimme erhalten, so Bonz. „Dieses Motiv ist vielfach benannt und auch auf unseren Exkursionen sehr greifbar geworden. Da muss es schmerzen, wenn sich die Gegenbewegung vollzieht: Eine Artikulation eines Subjekts wieder weg ist! Und zugleich kann gerade das nicht verwundern. Sind die Leben der Opfer doch tatsächlich unwiederbringlich verlorengegangen.“ Bianca Wessalowski führte aus, dass diese Tatsache sie in der Entwicklung des Projekt-Logos dazu gebracht habe, eine Type zu verwenden, die nicht voll sei, sondern eine Leerstelle aufweise. Das sei für sie gar nicht anders denkbar gewesen. Die Ausstellung stellt ein Zwischenergebnis des in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) geförderten Projekts ‚Grafeneck -Münster // 1940 – heute‘ dar. Weitere Ausstellungen werden im Laufe des Jahres folgen. Entsprechend gab es am Abend der Vernissage viel zu reden und Grund zu feiern.
Wirklichkeit als einen Raum erleben können, der zwischen den Menschen besteht
Aber auch die Schwere des Themas und sein Aktualitätsbezug kamen zur Geltung. Hat die jüngere historische Forschung zum Nationalsozialismus doch herausgearbeitet, wie wirkmächtig das Phantasma der ‚Volksgemeinschaft‘ und des ‚Volkskörpers‘ waren. Sie haben ein Gefühl der Zugehörigkeit, Motivationen für Handlungen, Sinn, ein Sein – kurz: sie haben eine Identität geschaffen. Ihre Identifikationskraft bezog diese Identität aus der Idealisierung des Identifikationsobjektes: der Zugehörigkeit zu einer vermeintlichen ‚Herrenrasse‘ – und aus der Konstruktion eines Außen, das als ‚minderwertig‘ galt, als ‚lebensunwert‘. Dieses abgewertete Außen hat die Identität überhaupt erst ermöglicht, weil sie diese bestätigte. Eine solche kulturelle Matrix, in der versucht wird, Identitätssicherheit über Größenphantasien und Entwertungen herzustellen, ist auch in unserer Zeit wirkmächtig. „Während Identifikationen, die auf Ausschluss basieren, durchdrungen sind von Aggressivität, einer grundlegenden, aggressiven Konkurrenz, wie sie der Psychoanalytiker Jacques Lacan in den späten 1940er Jahren beschreibt, sollen unsere Ausstellung und unser Projekt dazu beitragen, die Wirklichkeit als einen Raum erleben zu können, der zwischen den Menschen besteht. Als ‚Wesen von einzigartiger Verschiedenheit‘ nach Hannah Arendt sollen wir uns begegnen können“, schloss Bonz seine Eröffnungsansprache.
Text: Henrike Eifler, Alina Groß und Jochen Bonz
Fotos: Laura Windheuser (B-Side) und Tessa Ahlers
Weitere Veranstaltungen in dieser AusstellungWeitere Veranstaltungen während der Ausstellungsdauer sind Hannah Bischofs Präsentation ihres Gemäldezyklus’ „Zyklus für Maria“ am Samstag, 25.01.2025, und ein Podium mit Studierenden „Resonanzen – Wie war es und was bleibt von der Exkursion nach Grafeneck?“, am Donnerstag, 30.01.2025.
Kontakt
Prof. Dr. Jochen Bonz
Professor
Münster, Sozialwesen